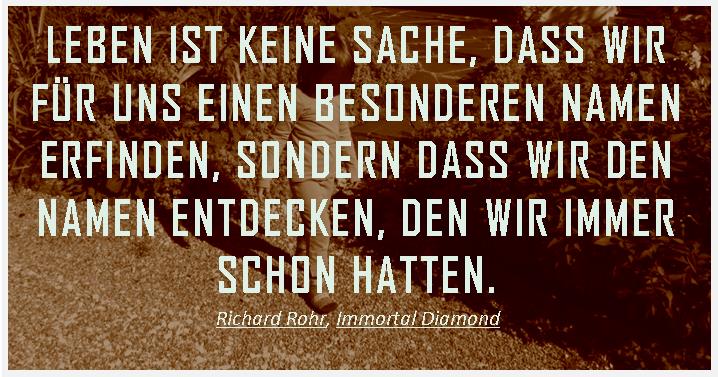Das Beste für den Menschen ist der andere Mensch. Darwin war der Auffassung, dass das Leben ein „Kampf ums Überleben" sei und Thomas Hobbes, dass „der Mensch dem Menschen ein Wolf" sei?
Oder Sartre: „die Hölle das sind die anderen"?
Gehört es nicht inzwischen zum allgemeinen Wissen, dass nur die, an die Umwelt am besten angepassten überleben?
Ist dieser Grundsatz des „survival of the fittest" nicht längst Allgemeingut geworden?
Hat nicht Richard Dawkins mit seinem „egoistischen Gen" eindeutig den Menschen als egoistisch klassifiziert?
Doch ist er das wirklich? Ist nicht vielmehr der Mensch als soziales Wesen auf Gemeinschaft hin angelegt? Findet er nicht seine Bestimmung in sozialen Beziehungen? Ist nicht jeder Mensch Teil eines sozialen Netzes? Will er nicht dazugehören? Teil sein von etwas Größerem? Mit anderen kooperieren?
Wenn wir auf die Zeit unserer Kindheit zurückschauen oder wenn wir Kinder sehen fällt sofort auf, wie wichtig ihnen Bezugspersonen sind. Ohne zuverlässige Bindungen wird es schwer für ein Kind sich gut zu entwickeln.
Im Evangelium beruft Jesus seine ersten Jünger. Simon, Andreas und dann die beiden Zebedäussöhne. Immer paarweise. Beide folgen Jesus. Gehen mit ihm, schauen wie er lebt, was er sagt und wie er handelt. Dabei fällt auf, dass die Berufenen aus dem Alltag heraus, aus der Sorge ums Überleben in Beziehungen hinein gerufen werden, in die Gemeinschaft mit Jesus. Der Kampf ums Überleben tritt dabei zurück und wird ersetzt durch den Einsatz für andere. Aus den Fischern werden „Menschenfischer“. Das Ziel des Menschenfischens ist es, Menschen zu gewinnen: füreinander und für Gott.
Zur Gemeinschaft dazugehören, ist die eigentliche Berufung des Menschen. Gemeinschaft heißt in erster Linie Kooperation und Zusammenarbeit und weniger Egoismus, und Konkurrenz. Indem wir für andere da sind, mit ihnen kooperieren, finden wir zu uns selbst, finden wir uns selbst. Unser Selbst ist in diesem Sinne ein dialogisches, soziales Selbst, ein Selbst, das im aus sich herausgehen zu sich selbst findet. Indem die Jünger Jesus nachgehen, ihm folgen, gehen sie etwas anderem als sich selbst nach. Sie gehen einem anderen Menschen nach und dabei finden sie zu sich selbst. Mensch sein heißt so, aufeinander zu zugehen, auf andere zu hören, sich gegenseitig zu achten, sich an andere zu binden, heißt in Beziehungen leben.
Jesus geht in der Berufungsgeschichte auf die Jünger zu, sieht sie an, sieht ihr Potential und geht auf sie ein.
In Jesus kommt Gott auf uns zu. In ihm sehen wir das uns zugewandte „Gesicht Gottes“. Gott bleibt so nicht nur der ganz andere, derjenige der unfassbar und unendlich größer ist als unsere Vorstellungskraft. Er wurde in Jesus Mensch, einer wie wir und bietet uns seine Beziehung, seine Freundschaft an.
Ist es nicht unendlich schön, dass die Beziehung zu Jesus eine Beziehung zu Gott ist? Eine Beziehung einerseits ganz menschlich, also eine Beziehung die im konkreten, endlichen, wechselhaften entsteht und die ins Unendliche, Göttliche hineinreicht?